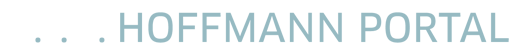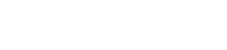[1] [Artikel] Ballett. In: Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. 3., gänzl. umgearb. Aufl. 15 Bde. Hildburghausen bzw. Leipzig 1874–78, Bd. 2 (1874), S. 476–478, 476.
[2] Friedemann Otterbach: Einführung in die Geschichte des europäischen Tanzes. Ein Überblick. Wilhelmshaven 1992 (Taschenbücher zur Musikwissenschaft 115), S. 106–115, Zitat 106f. Ferner über diese Entwicklung Rudolf Liechtenhan: Vom Tanz zum Ballett. Geschichte und Grundbegriffe des Bühnentanzes. 2., erw. Aufl. Stuttgart u. Zürich 1993, S. 53–73 u. 209 („Handlungsballett“); sehr lesenswert zur Geschichte des Balletts auch die Monographie Pierre Tugal: Jean-Georges Noverre. Der große Reformator des Balletts. Übers. aus d. Frz. von Tilly Bergner. Berlin [Ost] 1959; darin S. 117–160 Auszüge aus Noverres Lettres in der Übersetzung von Gotthold Ephraim Lessing.
[3] [Artikel] Ballett (Anm. 1), S. 477f.
[4] Für einen Historiker des Balletts wie Ferdinando Reyna: Histoire du ballet. Paris 1981 liegt denn auch der Gedanke einer teleologischen Verknüpfung der beiden Medien nicht fern. Seit das Ballett sich „fortement marqué par l’idée de pantomime et de danse ‚d’action‘“ zeige, sei die Tanzkunst „réellement le cinéma de l’époque“ (ebd., S. 81). Möglicherweise ist das Ballett in Hinsicht auf den Film überhaupt wirkungsmächtiger als die scheinbar näher liegende Oper gewesen.
[5] Den Eintrag im Werkkatalog von Jacques Malthète und Laurent Mannoni (2008) verzeichnet Klaus Kanzog: Reflexe der Werke E.T.A. Hoffmanns im Film. In: E.T.A.-Hoffmann Jahrbuch 17 (2009), S. 149–165, S. 153. Mehr als diese mageren Daten finden sich auch nicht im Katalog selbst; die von Kanzog erwähnten Abbildungen stehen in keinem Bezug zur Coppélia. Ein weiterer, ebd. verzeichneter Méliès-Film La Poupée vivante (F, 1909) muss nicht notwendig in unseren Zusammenhang gehören; da er gleichfalls verschollen ist, hätte allein ein direkt oder indirekt auf Hoffmann verweisendes Stichwort den Zusammenhang belegen können.
[6] Das folgende Resümee nach Charles Nuitter u. A[rthur] Saint-Léon: Coppélia ou La fille aux yeux d’émail. Ballet en deux actes et trois tableaux. Musique de Léo Delibes. Paris [1870]; dies.: Coppelia oder das Mädchen mit den Emaille-Augen. Ballet in zwei Abtheilungen. Dt. v. Ludwig Hartmann. Musik von L. D. Berlin [1878].
[7] Siehe die dt. Ausg. S. 4; original in der frz. Ausg. S. 15.
[8] Ebd., S. 8 bzw. S. 20.
[9] Ebd., S. 10 bzw. S. 22.
[10] Ebd., S. 10 bzw. S. 22.
[11] Ebd., S. 14 bzw. S. 26f.
[12] Dieses abschließende „tableau“ bringt die dt. Übersetzung von 1878 nicht. Im frz. Original S. 31–34.
[13] Benutzter Überlieferungsträger: Datei in https://www.youtube.com/watch?v=fZNOSSUpKnc