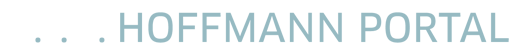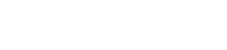[1] Klaus Kanzog: Reflexe der Werke E.T.A. Hoffmanns im Film. In: E.T.A.-Hoffmann Jahrbuch 17 (2009), S. 149–165, S. 151 hatte seine Zugänglichkeit für den Abschluss der Restaurierung 2010 in Aussicht gestellt. Mittlerweile sind nach Auskunft des Archivs aber „neue Versionen“ gefunden worden, und es ist zukünftig eine erneute „digitale Restaurierung“ vorgesehen (frdl. Mitteilung Frau Susanne Rocca vom 31. Januar 2019). Bei dieser Sachlage habe ich vorderhand auf eine Autopsie verzichtet.
[2] Argus: Neuheiten auf dem Berliner Filmmarkte. In: Der Kinematograph, Nr. 479 (1.3.1916); zitiert nach dem Abdruck in: Zwischen Revolution und Restauration. Kultur und Politik 1789–1848 im Spiegel des Films. Katalog Cinefest – XIV. Internationales Festival des deutschen Film-Erbes. Hg. von Cinegraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung und Bundesarchiv. [Hamburg 2017], S. 20. Der Film wurde im Rahmen des Hamburger Cinefestes am 25. November 2017 gezeigt.
[3] In der deutschen Synchronfassung wurde E.T.A. Hoffmann von Rudolf Schock gesungen.
[4] Eine sehr informative und zugleich gedrängte Darstellung des Films findet sich bei Scott Salwolke: The Films of Michael Powell and the Archers. Lanham, Md. u. London 1997 (Filmmakers Series 52), S. 191–199, das Zitat S. 192; zu den sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekten des Kinos im Umfeld von The Tales of Hoffmann siehe Andrew Moor: Powell & Pressburger. A Cinema of Magic Spaces. London u. New York 2005, S. 219–228.
[5] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[6] Zur Information über den aktuellen Stand der Textkritik von Les Contes d’Hoffmann sei verwiesen auf die leicht zugängliche (und preiswerte) vorzügliche Edition Jacques Offenbach: Les Contes d’Hoffmann. Hoffmanns Erzählungen. Fantastische Oper in fünf Akten. Textbuch Französisch / Deutsch. Übers. u. hg. v. Josef Heinzelmann. Stuttgart 2005 (Reclams Universal-Bibliothek 18329).
[7] Der Begriff wurde 1972 von Gérard Genette eingeführt zur Bezeichnung all jener Fälle, in denen es zu einer Überschreitung oder Verwechslung zwischen der erzählten Welt und derjenigen des Erzählvorgangs oder, auffälliger noch, derjenigen des Autors kommt. Siehe G. G.: Discours du récit. Essai de méthode. In: Ders.: Figures III. Paris 1972, S. 65–278, hier 243–246; dt. G. G.: Die Erzählung. Aus d. Frz. v. Andreas Knop. Mit e. Vorw. v. Jochen Vogt. München 1994, S. 167–169. Vgl. ferner Matias Martínez u. Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München 1999, S. 79f. u. 190. Genette selbst hat sich dieser Erzählfigur nochmals gewidmet in G. G.: Métalepse. De la figure à la fiction. Paris 2004, hier S. 10–13 der theoretische Aufriss, was an Beispielen dann folgt, erbringt wenig Neues; gleichfalls nur auf Französisch liegt vor: Métalepses. Entorses au pacte de la représentation. Hg. v. John Pier u. Jean-Marie Schaeffer. Paris 2005 (Recherches d’histoire et de sciences sociales 108).
[8] E.T.A. Hoffmann: Fantasie- und Nachtstücke. Fantasiestücke in Callots Manier. Nachtstücke. Seltsame Leiden eines Theater-Direktors. Hg. u. mit e. Nachw. vers. v. Walter Müller-Seidel, mit Anm. v. Wolfgang Kron. München 1960, S. 256.
[9] Ich folge damit dem Vorgang von Kanzog: Reflexe im Film (Anm. 1), S. 160f.; Standort und Signatur: Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin, Schriftgutarchiv, 4.4-198528, 36. Über Paul Martin und seinen Film kurz auch Ringel: E.T.A. Hoffmanns Werke (Anm. 1), S. 88.
[10] Kanzog: Reflexe im Film (Anm. 1), S. 161. Allerdings irrt Kanzog im Referat eines nicht unwichtigen Details: Führer einer Kompanie ist (nicht im Ersten, vielmehr) im Zweiten Weltkrieg nicht Alexis Wilbrand, sondern der blutjunge und nach dem Zusammenbruch des „Reiches“ als Student sein Leben neu beginnende Albert Winter.
[11] Benutzter Überlieferungsträger: Datei unter https://www.youtube.com/watch?v=1lXf6abyNzg
[12] Bereits 2012 hatte Klaus Kanzog: Reflexe der Werke E.T.A. Hoffmanns im Fernsehen. In: E.T.A.-Hoffmann Jahrbuch 20 (2012), S. 139–155, S. 155 den damals nur „durch einen Trailer bekannt gewordene[n] russische[n] Animationsfilm Gofmanniada [sic] von Stanislav Sokolov“ avisiert, dessen Fertigstellung für Mai 2014 vorgesehen sei. Tatsächlich aber kam das aufwendig produzierte und deshalb teure und für die Produzenten nur mit Unterbrechungen zu finanzierende Werk nach immer erneuten Verschiebungen des Termins erst Ende 2018 zur Uraufführung. Der Film, der bisher nur zu wenigen und jeweils eigens angekündigten Terminen zu sehen war, wird hier nach seiner gegenwärtig im Netz vorliegenden Version (71 min.) vorgestellt. Benutzter Überlieferungsträger: Datei, zugänglich unter https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0&path=wizard&noreask=1