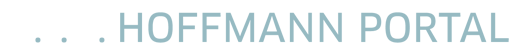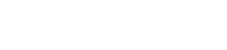[1] Vorgelegen hat mir nicht ein eigentliches Libretto, sondern ein handschriftlich überlieferter musikalisch-szenischer Plan Petipas zum Nußknacker, in deutscher Übersetzung ediert in: Marius Petipa. Meister des klassischen Balletts. Selbstzeugnisse Dokumente Erinnerungen. Hg. von Eberhard Rebling. Berlin [Ost] 1975, S. 127–134.
[2] Einzig Drosselmeier und Fritz, typisch deutsche Namensbildungen, bleiben in Petipas Ballett (wie auch den späteren Filmen) unangetastet; Hoffmanns Marie wird in Ballett und Verfilmungen meist als Clara geführt.
[3] Petipa (Anm. 1), S. 131f.
[4] Gabriele Brandstetter: Transkription in Tanz. E.T.A. Hoffmanns Märchen ‚Nußknacker und Mausekönig‘ und Marius Petipas Ballett-Szenario. In: Jugend – ein romantisches Konzept? Hg. von Günter Oesterle. Würzburg 1997 (Stiftung für Romantikforschung 2), S. 161–179, 168f.
[5] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[6] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[7] Ein Genuss besonders für das erwachsene Kinopublikum dürfte die Figur des überforderten Haudegens Pantalon („Pantaloon“) aus Fritzens Armee sein, die hinreißend von Peter O’Toole gesprochen wird.
[8] Arno Meteling: E.T.A. Hoffmanns Wirkung im Film und in der Literatur nach 1945. In: E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. Hg. von Detlef Kremer. 2., erw. Aufl. Berlin u. New York 2010, S. 581–591, S. 586.
[9] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[10] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[11] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[12] So Konchalowskij selbst in seinen Äußerungen in The Making of Andrei Konchalovsky’s ‚Nutcracker‘ (2010); zu finden als Beigabe auf dem benutzten Überlieferungsträger.
[13] Eine nicht genug zu rühmende Ausnahme von der mehr als hundertjährigen Blindheit der Germanistik gegenüber dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des Märchens bildet Wulf Segebrecht: E.T.A. Hoffmanns ‚Nußknacker und Mausekönig‘ – nicht nur ein Weihnachtsmärchen. In: In: E.T.A.-Hoffmann Jahrbuch 17 (2009), S. 62–87.
[14] Benutzter Überlieferungsträger: DVD.
[15] Wir haben es offensichtlich mit einer schwindelerregenden linguistischen Konfusion zu tun, der nicht weiter nachgegangen werden kann. Die hier Mutter Ingwer genannte Figur jedenfalls ist in ihrer Bühnenrepräsentation bei Petipa und Tschaikowskij (und so auch im Film) eine „mère gigogne“, eine Matrjoschka, eine russische Puppe.