Bestiarien des Imaginären – Tiere und andere Formen nichthumaner Alterität in der spekulativen Literatur. 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Fantastikforschung (GfF)
vom 28.-30. August 2025, Justus-Liebig-Universität Gießen
Deadline Abstract: 31.01.2025
–
English Version below
–
Die Welt der spekulativen Literatur sowie Unterhaltungsmedien ist ein faszinierendes Universum, in dem fantastische Wesen und nicht-menschliche Alteritäten leben und agieren. Fantastische Tierwesen bevölkern das Universum spekulativer Literatur nicht erst seit J.K. Rowlings neuerer Erzählung bzw. Filmserie Fantastic Beasts (2016-2022). Von den frühneuzeitlichen Anfängen moderner fantastischer Literatur bis zu den aktuellen Ausprägungen spielen Tiere und menschliche Alteritäten über Fabelwesen bis hin zu technischen Modifizierungen des menschlichen Körpers oder dessen Substitution durch Roboter und Maschinen aller Art eine charakteristische Rolle in den verschiedenen Narrationen.
Tiere haben als companion animals, als Begleiter und entscheidende Helferfiguren, als Seelenverwandte oder mitunter als mächtige Gegenspieler eine konstitutive Rolle für den Handlungsverlauf, die Entwicklung der Charaktere und die Ausdifferenzierung des Worldbuilding inne. Ihre Präsenz als signifikante Formen nicht-menschlicher Alterität ist aus den genrespezifischen Texten nicht wegzudenken. In den Varianten der Science Fiction und der modernen Dystopie treten neben extraterrestrischen oder fremdartigen biologischen Formen oft auch technomorphe Spezies an ihre Stelle, die ähnliche Funktionen übernehmen können. Nicht selten werden hierbei auch ethische und moralische Fragestellungen der Mensch-Technologie-Beziehung verhandelt. Auch im Bereich des Horrors und anderen Spielarten der spekulativen Literatur finden sich verschiedene Ausprägungen nicht-menschlicher Figuren.
Die Tagung setzt sich zum Ziel, nicht allein das weitgefächerte Spektrum fantastischer Tierarten und technomorpher Spezies auszuloten, sondern auch deren unterschiedliche Rollen und Funktionen als eigenständige Akteure neben den menschlichen Protagonisten zu analysieren und ihre jeweilige philosophische bzw. ihre ideengeschichtliche Dimension zu erkunden. Dabei geht es meist um nichts weniger als eine menschliche oder anthropologische Selbstverortung, die durch die Ausgestaltung der Mensch-Tier-Beziehung bzw. der Beziehung der menschlichen Figuren zum außermenschlichen Anderen implizit vollzogen wird. Neben literatur- und kulturwissenschaftlichen Ansätzen zum hier skizzierten Themenkomplex sind auch Beiträge aus anderen Disziplinen wie beispielsweise Religionswissenschaft, Sozialwissenschaft, Psychologie bis hin zur Kombination von naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Forschungsansätzen herzlich willkommen.
Neben der thematischen Fokussierung auf die Bestarien des Imaginären bietet die Tagung auch einen Open Track für Beiträge aller Art rund um die Fanastikforschung.
Bitte reichen Sie Ihr Paper im Umfang von 350 Wörtern (auf deutsch oder englisch) mit einer Kurzbiographie (Umfang 150 Wörter) bis zum 31.01.2025 unter folgender E-Mail-Adresse ein: gff2025@uni-giessen.de
Die GfF vergibt auch dieses Jahr wieder Reisestipendien für Studierende (BA, MA, Promotion etc.). Wenn Sie sich für ein Reisestipendium in Höhe von 200€ bewerben möchten, geben Sie dies bitte bei Einreichung Ihres Papers an.
Bei Fragen aller Art wenden Sie sich gerne an unser Team:
Prof. Dr. Annette Simonis und Dr. Laura Zinn: gff2025@uni-giessen.de
Bestiaries of the Imaginary — Animals and Other Forms of Non-Human Alterity in Speculative Literature.
16th Annual Conference of the Gesellschaft für Fantastikforschung (GfF)
August 28-30, 2025, Justus-Liebig-Universität Gießen
Deadline Abstract: 31.01.2025
Fantastic creatures have populated the universe of speculative literature not only since J.K. Rowling’s recent story and film series Fantastic Beasts (2016-2022). From the early modern beginnings of modern fantastic literature and other media to current manifestations, animals and forms of human alterity, ranging from mythical beings to technical modifications of the human body or its substitution by robots and machines of all kinds, play a characteristic role in various narratives.
Animals serve as companion animals, crucial helper figures, soulmates, or sometimes as powerful adversaries, constituting a vital part of plot development, character evolution, and the differentiation of worldbuilding. Their presence as significant forms of non-human alterity is indispensable in genre-specific texts. In the variants of science fiction and modern dystopia, alongside extraterrestrial or exotic biological forms, technomorphic species often take their place, fulfilling similar roles. Ethical and moral questions regarding the human-technology relationship are frequently explored within this context. Various manifestations of non-human figures can also be found in horror and other forms of speculative literature.
The conference aims not only to explore the wide-ranging spectrum of fantastic animal species and technomorphic beings but also to analyze their different roles and functions as independent actors alongside human protagonists and to investigate their respective philosophical or historical dimensions. This often involves nothing less than a human or anthropological self-positioning, implicitly executed through the design of the human-animal relationship or the relationship of human characters to the non-human Other. Contributions from literary and cultural studies are welcome, as well as submissions from other disciplines such as religious studies, social sciences, psychology, and the combination of natural and humanities research approaches.
In addition to the thematic focus on the bestiaries of the imaginary, the conference also offers an Open Track for contributions of all kinds related to fantasy research.
Please submit your abstract of 350 words (in German or English) along with a short biography (150 words) by January 31, 2025, to the following email address: gff2025@uni-giessen.de.
The Society for Fantasy Research is again offering travel grants for students (BA, MA, PhD, etc.) this year. If you would like to apply for a travel grant of €200, please indicate this when submitting your paper.
If you have any questions, feel free to contact our team:
Prof. Dr. Annette Simonis and Dr. Laura Zinn: gff2025@uni-giessen.de
Contact Information
Prof. Dr. Annette Simonis und Dr. Laura Zinn
Justus-Liebig-Universität Gießen
FB 05 Germanistik/Komparatistik
Contact Email
gff2025@uni-giessen.de
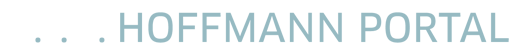
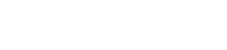


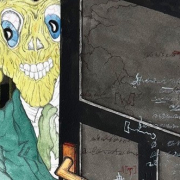

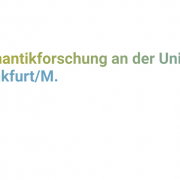
![Die Kupferminen zu Fahlun in Schweden (1841) Meyer’s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. 8. Band Bibliographisches Institut, Hildburghausen [https://de.wikipedia.org/ wiki/Datei:Meyers_Universum_Band_08_45.jpg, gemeinfrei]](https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/wp-content/uploads/Fahlun-Minen_blog-180x180.jpg)

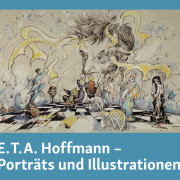

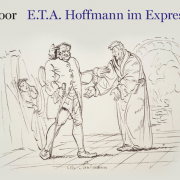
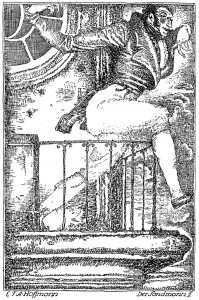

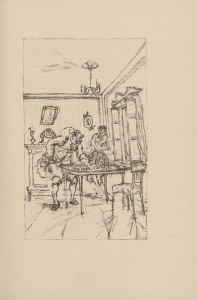
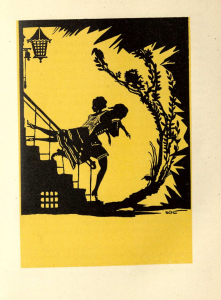
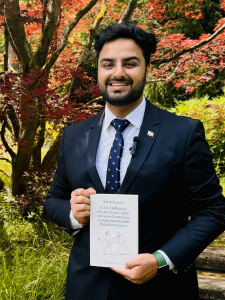
 © Staatsbibliothek Bamberg
© Staatsbibliothek Bamberg
