von Agathe Duperron (MA, Universität Heidelberg) und Emily Patzer (BA, Freie Universität Berlin)
Am 2. und 3. November 2023 fand in Berlin die internationale Jahrestagung der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft statt, die sich mit den Themen „Rezeption, Adaption und Interpretation“ auseinandersetzte. Am ersten Tag standen die Schwerpunkte Übersetzung, Hörspiel und Film im Zentrum. Blagovest Zlatanov[i] (Universität Heidelberg) befasste sich in seinem Beitrag mit E.T.A. Hoffmanns Rezeption im Bulgarien der Zwischenkriegszeit, wobei er den Begriff des Ruhmtransfers ins Zentrum seiner Überlegungen stellte. Neben der romantischen Renaissance, die Bulgarien in den 1920er- und 1930er-Jahren erlebte, war vor allem die Adaption Hoffmanns durch andere, in Bulgarien viel gelesene Texte Grund für Hoffmanns literarischen Ruhm. Beispielhaft zu nennen sind die Autoren Fjodor Dostojewski, Hugo von Hoffmannsthal und Iwan Turgenjew, die von Hoffmann, dem Meister des Übernatürlichen, beeinflusst waren. Die Rezeption in der Zwischenkriegszeit ist durch die nachfolgende Generation bulgarischer Autorinnen und Autoren, die aufgrund ihrer Sprachkenntnisse Hoffmann im Original lesen konnten, vorangetrieben worden.

E.T.A. Hoffmann Tagung 2023 – Vortrag Ingrid Lacheny | SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0
Die zweite Referentin, Fiona O’Donnell (Université de Toulouse), thematisierte die hybride Leseerfahrung und die visuelle Gestaltung des Fantastisch-Grotesken in Tristan Bonnemains illustriertem Buch Dans la nuit d’E.T.A. Hoffmann. Tristan Bonnemain, Illustrator und Künstler aus Marseille, brachte das Buch 2022 im Typhon Verlag heraus, Philippe Forget lieferte die Übersetzung ins Französische. In dieser Publikation wirken Bild und Wort gleichberechtigt zusammen und ermöglichen so der Leserschaft eine hybride Leseerfahrung. Das Illustrieren einer Erzählung stellt, genau wie eine Übersetzung, einen Akt der Interpretation dar, wodurch wiederum die Rezeption beeinflusst werden kann. Das Groteske – ein zentrales Motiv bei Hoffmann – kann als ästhetische Kategorie verstanden werden. Fiona O’Donnell beschrieb das visuelle Zusammenwirken von Text und Illustration, die dadurch evozierten Emotionen sowie die intendierte Führung der Lesenden am Beispiel einer gezeichneten Treppe, die der Sandmann besteigt. Das erste Panel schloss mit dem Vortrag von Ingrid Lacheny (Université de Lorraine), die der Frage nachging, ob man Hoffmann beim Übersetzen ins Französische verrate oder verrate. „Verraten“ könne einerseits im Sinne eines Erklärens oder Aufdeckens verstanden werden und andererseits als Untreue an der Sprache durch das Übersetzen. Die Referentin wählte für das 19. bis 21. Jahrhundert jeweils eine bekannte Übersetzung aus, an der sie die grundsätzlichen Schwierigkeiten des Übersetzens illustrierte. Im 19. Jahrhundert übersetzte erstmals François-Adolphe Loève-Veimars Texte von E.T.A. Hoffmann, wobei er den Geschmack des französischen Publikums und seine eigenen Vorlieben stärker gewichtete als die Akkuratheit der Übersetzung und somit dem Original zugunsten einer Orientierung am Zielpublikum untreu wurde. Als Vertreterin der Methode, dem Original so treu wie möglich zu bleiben, kritisierte Madeleine Laval, eine Übersetzerin des 20. Jahrhunderts, ihren Vorgänger: Dieser habe Hoffmann mit seiner freien Übersetzung verkannt. Philippe Forget, der jüngst für die Illustrationen von Tristan Bonnemain eine neue Übersetzung Hoffmann’scher Texte vornahm, legte ebenfalls Wert auf einen ausgangssprachlichen Schwerpunkt.
Das zweite Panel wurde durch Beata Kornatowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) eröffnet. Sie analysierte Hoffmann-Adaptionen im polnischen Hörspiel, wobei sich das Medium als tiefgreifende Interpretation eines Textes erweist. Im Hörspiel werden bis ins Detail Stimmfarben der Sprecherinnen und Sprecher, dramaturgische Fragen, Musikauswahl oder auch Fragen der Darstellung einer Figurenentwicklung durchdacht und inszeniert. Am Beispiel dreier Adaptionen stellte sich heraus, dass nicht zuletzt das Medium dazu auffordert, Entscheidungen im Umgang mit dem Originaltext zu treffen, die wiederum eine eigene Interpretation darstellen. Eine besondere Stärke der Radioadaption ist das logozentrische Moment, das eine einzigartige Intimität herstellt.
Die beiden letzten Beiträge beleuchteten Adaptionen des Hoffmann’schen Werkes im Film. Sotera Fornaro (L’Università degli Studi della Campania) diskutierte Christian Petzolds Film Undine (2020) und seine Referenzen auf Hoffmanns gleichnamige Oper. Petzold siedelt das Geschehen in der Gegenwart in Berlin an. Undine ist eine Historikerin, die bei Führungen unter anderem über die berühmten Schinkel-Bauten spricht – jener Schinkel, der auch für die Uraufführung von Hoffmanns Oper 1816 das Bühnenbild entworfen hat. Diese und mehr Parallelen und Querverweise stellte Fornaro in ihrem Vortrag vor und schloss mit der Deutung, dass das Schicksal Undines im Film mit dem Schicksal der Stadt Berlin parallel gesetzt werde.
Das Panel beschloss Corinna Schlicht (Universität Duisburg-Essen) mit einer Analyse von David Lynchs Film Lost Highway (1997), in der sie dessen Parallelen zu Hoffmanns Sandmann aufzeigte. Das Thema des Films ist die Ermordung der Liebespartnerin durch den Protagonisten, woraufhin der Mörder dissoziiert und einen eigenen Doppelgänger seiner selbst hervorbringt. Neben dem Ehepaar fungiert ein „Mystery Man“ als unheimlicher, das Geschehen lenkender Dritter und greift so die Rolle der Figur Coppelius/Coppola in Hoffmanns Sandmann auf – so Schlicht. Die entscheidende Parallele machte die Referentin an der Konstitution des Wahnsinns bzw. der psychischen Krise der männlichen Hauptfiguren fest: die Enge des bürgerlichen Lebensentwurfes.

E.T.A. Hoffmann Tagung 2023 – Filmvorführung „Zauber um Zinnober“ – Podiumsdiskussion | SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0
Das Abendprogramm bestand in der Filmvorführung der DEFA-Verfilmung „Zauber um Zinnober“ von Celino Bleiweiß (1983) mit anschließender Podiumsdiskussion mit Dennis Schäfer (Princeton University), Dr. Stephanie Großmann (Universität Passau), Dr. Elizabeth Ward (Universität Leipzig) und Dr. Anett Werner-Burgmann (Universität Köln).
Der zweite Tag begann mit einer Präsentation des neuen Kurators des Hoffmann-Hauses in Bamberg, Boris Roman Gibhardt, der derzeit in Zusammenarbeit mit einem Architekten und einer Gestaltungsfirma die Räumlichkeiten im Hinblick auf die geplante Wiedereröffnung im Jahre 2026 neu konzipiert. Gibhardt stellte die vier Hauptpfeiler des Projekts vor: Das neue Haus wird nicht nur Hoffmanns Biografie, sondern auch bedeutsame Hoffmann’sche Themen präsentieren, die insbesondere einen starken Bezug zur Gegenwart hervorheben werden. Im Zentrum sollen dabei die Fantasiestücke stehen, da die erste Sammlung in Bamberg verfasst und veröffentlicht wurde. Damit die neue Dauerausstellung ein breites Publikum in und außerhalb Deutschlands anspricht, soll die Rezeption von Hoffmann in der populären Kultur hervorgehoben werden. Das Hauptziel besteht darin, komplexe und fachliche Inhalte leicht verständlich zu formulieren. Die Ausstellung strebt danach, ein Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher zu bieten, wofür Hoffmanns Poetenstübchen als Highlight sowohl als wirklicher als auch als fiktionalisierter Ort inszeniert wird. Während der Interimsphase sind mediale Angebote wie ein Podcast mit Interviews von verschiedenen Personen, die sich mit Hoffmann beschäftigen, geplant.
Es folgte das zweite Panel zu den Medialen Adaptionen. Elena Giovannini (Università del Piemonte Orientale) hielt einen Vortrag über die Graphic Novel Sandmann von Michael Mikolajczak und Jacek Piotrowski (Leipzig 2019), eine intermediale Literaturadaption des gleichnamigen Texts Hoffmanns. Sie erläuterte Beispiele für formale und inhaltliche Abweichungen vom Original, wie beispielsweise die Kompensation der fehlende Briefform durch die visuellen Markierungen unterschiedlicher Perspektiven und die grundlegenden Eingriffe in das Sujet, indem Clara und Nathanael ein Ehepaar bilden. Als Kern dieser Adaption arbeitete Giovannini die Darstellung der Psychopathie heraus, was sie an der Konzeption der Figur Olympia und verschiedener intertextueller Referenzen auf die bildende Kunst exemplifizierte. Die Graphic Novel zeichnet sich durch geschickte Kombination und Montage aus und stellt somit eine gelungene kreative Adaption in ein neues Medium dar.
Julian Lembke (ENS de Lyon) widmete sich drei musikalischen Bearbeitungen des Sandmanns, die unterschiedliche Perspektiven auf den Ausgangstext bieten. Die erstmals 1991 aufgeführte Oper Heaven Ablaze In His Breast von Judith Weir und Ian Spink kann in ihren klanglichen Überlagerungen als Palimpsest beschrieben werden. Ihre Inszenierung vereint zeitgenössischen und klassischen Tanz und greift das Doppelgängermotiv auf. Die Oper The Sandmann (2002) Thomas Cabaniss und Douglas Langworthy, stellt laut Lembke zugleich eine Hommage an Hoffmann als auch eine radikale Neuinterpretation seines Werks dar. Für Andrea Lorenzo Scartazzinis und Thomas Jonigks Der Sandmann (2012), einer Oper für junge Erwachsene, stellte Lembke heraus, wie sie die Originalhandlung variiert und insbesondere die trügerische Natur der Figuren verstärkt.
Im Panel „Textanalyse – Looking close“ argumentierte Dorothee Ostmeier (University of Oregon) in ihrer Interpretation von Meister Floh, dass Hoffmann durch die affirmative Darstellung neuer wissenschaftlicher Instrumente wie Linsen, Mikroskope oder Fernrohre in einen Diskurs über die technologische Revolution des 17. und 18. Jahrhunderts eingebunden ist. Diese Objekte erweiterten zwar die Denkmöglichkeiten des Menschen, aber Hoffmann weigert sich in seiner Erzählung, die Denkmuster seiner Zeit kritiklos zu akzeptieren, so Ostmeier. Er reflektiert die dominierende Stellung des Menschlichen im Vergleich zum Nicht-Menschlichen (Automat oder Tier), damit zeigt er nicht nur sein Interesse am technischen Fortschritt, sondern kritisiert auch den Allwissenheitsanspruch der Aufklärung.
Sebastian Speth (Universität Münster) widmete sich der juristischen Perspektive auf das literarische Schaffen Hoffmanns. Anhand der Elixiere des Teufels hob er hervor, dass großes Interesse an der menschlichen Seele hatte und sich u.a. mit der Frage nach der Willensfreiheit während des Strafprozesses auseinandersetzte. Hoffmann scheint sich mit Schaumanns Ideen zu einer Kriminalpsychologie (Halle 1792) auseinandergesetzt zu haben, in dem der Philosoph die Taten von Verbrecherinnen und Verbrechern aus einer anderen Perspektive betrachtet. Die Figur des Delinquenten Medardus stellt in dieser Hinsicht einen kriminalpsychologisch anspruchsvollen Fall dar, da dieser unter Gedächtnislücken leidet und in seiner Fantasie lebt. Hoffmann versetzt damit die Lesenden implizit in eine richtende Position, in der sie darüber entscheiden sollen, ob der Bericht des Medardus wahr ist oder nicht.
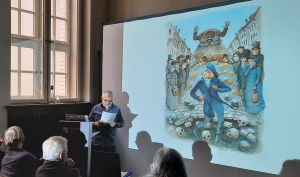
E.T.A. Hoffmann Tagung 2023 – Lesung Steffen Faust | SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0
Ihren krönenden Abschluss fand die Tagung mit Steffen Fausts (Freier Illustrator, Berlin) Lesung von E.T.A. Hoffmanns Der goldne Topf, in der er 30 seiner bestechenden und luziden Illustrationen zum Text präsentierte.
Bilanzierend lässt sich sagen, dass die exzellenten Vorträge der beiden Tage ganz im Zeichen des Tagungsthemas standen. Sie verfolgten sowohl historische, inter- und transmediale sowie übersetzungstheoretische Fragestellungen und bildeten die Grundlage für äußerst fruchtbare Plenumsdiskussionen. E.T.A. Hoffmann, der Meister des Fantastisch-Grotesken, strahlt noch immer vielfältig in unsere Gegenwart hinein.
[i] Da Prof. Zlatanov nicht persönlich teilnehmen konnte, wurde sein Vortrag in Abwesenheit verlesen.
Tagungsprogramm
Die Tagung fand in Kooperation mit der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft und der Université de Lorraine – CEGIL statt.
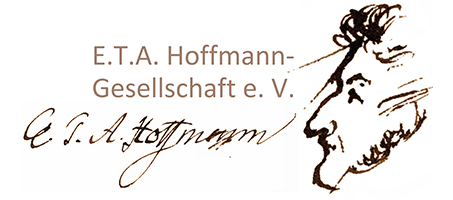

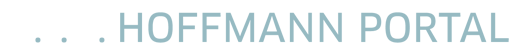
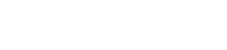

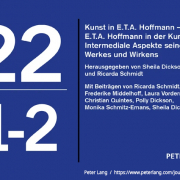 Peter Lang / https://www.peterlang.com/journal/14/45-1-2
Peter Lang / https://www.peterlang.com/journal/14/45-1-2
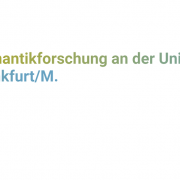



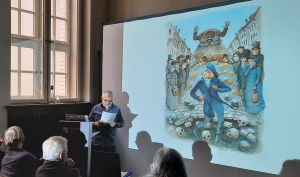
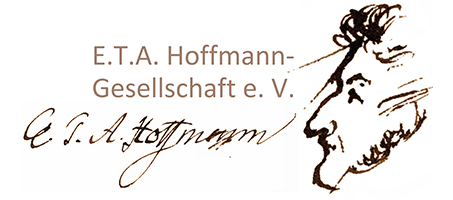

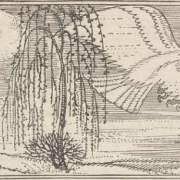 © In Copyright
© In Copyright
 http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00021D9300000009
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00021D9300000009 
